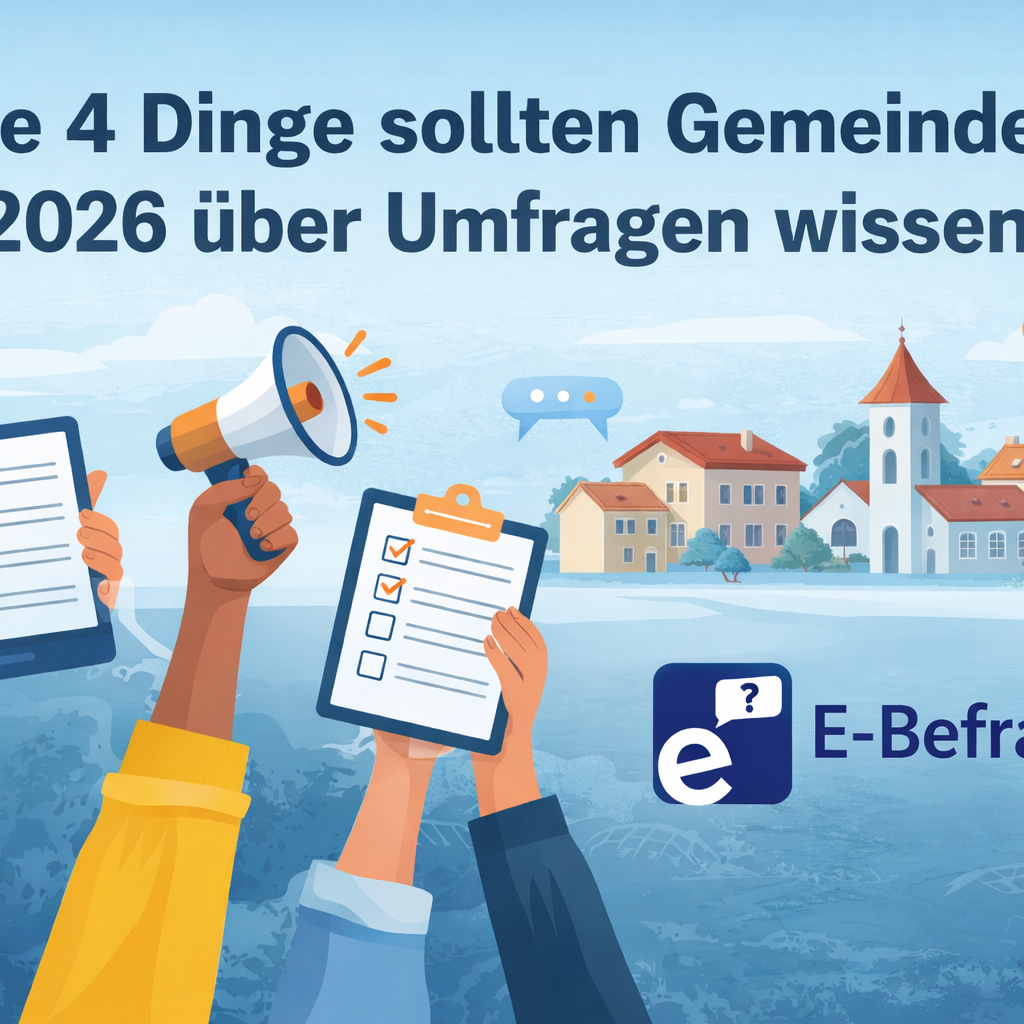Komplementäre Formen von Demokratie
Das Zentrum für Demokratie in Aarau hat einen Bevölkerungsrat begleitet zum Thema Gesundheitsförderung und Prävention.
Beim Bevölkerungsrat 2025 handelte es sich um ein Forschungsprojekt der beiden Universitäten Zürich und Genf. Es geht um die Untersuchung komplementärer Formen von Demokratie. Inhalt ist eine gesprächsorientierte Form der Partizipation. Es geht um den Austausch von Meinungen und Perspektiven. Die Mitglieder werden ausgelost. Dadurch soll eine vielfältige Zusammensetzung gewährleistet sein. Das Format soll einen gehalt- und respektvollen Diskurs über ein kontroverses oder politisch festgefahrenes Thema führen. Andri Heimann vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) hat mitgewirkt.
Herr Heimann, wenn man in wikipedia nachschlägt, wird Wolfgang Schäuble zitiert, der Bürgerräte wichtig findet «um die Bindung zwischen den Wählern und Gewählten zu stärken». Teilen Sie diese Auffassung?
Ja, diese Einschätzung teile ich. Bürgerräte zeigen exemplarisch, welchen Mehrwert solche Dialogräume bieten: Diejenigen, die daran teilnehmen, gewinnen ein besseres Verständnis über politische Prozesse und die Herausforderungen, die hinter politischen Entscheidungen stehen. Und die gewählten Politikerinnen und Politiker gewinnen ein besseres Verständnis dafür, welche Themen und Anliegen einem informierten Querschnitt der Bevölkerung wichtig sind. Bürgerräte können dazu beitragen, das Vertrauen in die repräsentative Demokratie zu stärken.
Werden durch solche Verfahren gesellschaftliche Debatten gefördert und politische Polarisierungen reduziert?
Das ist eine der zentralen Fragen unseres Forschungsprojekts «Bevölkerungsrat 2025». Bürgerräte fördern respektvolle und konstruktive Auseinandersetzungen und ermöglichen ein gemeinsames Ringen um Lösungen – selbst bei kontroversen Themen. Diejenigen, die an solchen Verfahren teilnehmen, erleben oft, wie sich ihre Meinung durch den Austausch mit anderen weiterentwickelt und in manchen Fällen auch ändert. Extreme Meinungen werden eher abgeschwächt. Herauszufinden, ob sich solche Effekte auch auf Personen übertragen lassen, die selbst nicht Teil der Diskussionen waren, ist unter anderem ein Ziel unseres Projekts.
Wie verfolgen Sie dieses Ziel?
Um diese Wirkungen systematisch zu untersuchen, kombinieren wir qualitative und quantitative Methoden: Einerseits erfassen wir Veränderungen bei den Teilnehmenden selbst – etwa in Bezug auf ihr Vertrauen in die Politik, ihre politische Gesprächsbereitschaft oder ihre Einstellungen zu gesundheitspolitischen Themen. Andererseits analysieren wir mit Hilfe von Bevölkerungsumfragen, ob und wie die Ergebnisse und der öffentliche Diskurs rund um den Bevölkerungsrat auch Menschen ausserhalb des Verfahrens erreichen und zum Nachdenken oder Diskutieren anregen.
Im Verfahren wurden 27’000 zufällig ausgewählte Personen eingeladen. Aus den Interessierten wurden 100 für die Teilnahme ausgelost. War die Vermögenslage auch ein Kriterium? Im alten Rom gab es ja das Zensuswahlrecht.
Nein, die Vermögenslage war kein Kriterium. Für das Losverfahren berücksichtigt wurden Alter, Geschlecht, Ausbildung, Wohnort, politische Einstellung und Abstimmungshäufigkeit. Der Bevölkerungsrat bildet die Vielfalt der Schweizer Wohnbevölkerung hinsichtlich dieser Kriterien ab. Die Vermögenslage korreliert stark mit der höchsten abgeschlossenen Ausbildung, deshalb haben wir dieses Kriterium nicht berücksichtigt.
Die angeschriebenen Personen waren eingeladen aus fünf möglichen Themen auszuwählen. Wer hat die Auswahl dieser Themen festgelegt?
Die Themenauswahl wurde in einem mehrstufigen Verfahren getroffen. Zunächst wählte das Projektteam elf geeignete Themen aus, basierend auf Relevanz und Eignung für einen Bevölkerungsrat. Danach wurden die Fraktionen im Parlament konsultiert. Schliesslich konnten die eingeladenen Personen aus fünf priorisierten Themen auswählen. Über 40 % sprachen sich für das Thema steigende Gesundheitskosten aus – deutlich mehr als für alle anderen (siehe https://www.pnyx25.uzh.ch/de/thema.html).
Die 100 Teilnehmenden trafen sich an drei Wochenenden zwischen November 2024 und März 2025 in Zürich, Neuenburg und Bern sowie viermal online. Wie wurden die Teilnehmenden entschädigt, im Detail?
Alle Teilnehmenden erhielten eine pauschale Aufwandsentschädigung für jedes Treffen (100.-/Tag). Zudem wurden die Reise- und Übernachtungskosten vollständig übernommen. Auch Kinderbetreuungskosten konnten rückerstattet werden. Ziel war es, möglichst allen eine Teilnahme zu ermöglichen – unabhängig von ihrer finanziellen Lebenssituation.
Ist vorgesehen, in diesem Jahr ebenfalls einen nationalen Bevölkerungsrat einzusetzen?
Meines Wissens ist für dieses Jahr kein weiterer nationaler Bevölkerungsrat geplant. Ob und wie künftig weitere solcher Bevölkerungsräte stattfinden, hängt vor allem auch vom politischen Interesse und der Nachfrage ab. Das Potenzial für solche Bevölkerungsräte ist auf jeden Fall auf allen politischen Ebenen, von der kommunalen bis zur nationalen Ebene vorhanden.
Was empfehlen Sie Gemeinden, die solche Prozesse aufgleisen möchten?
Zunächst sollte sich eine Gemeinde fragen, weshalb sie einen solchen Beteiligungsprozess durchführen möchte. Gibt es ein konkretes, vielleicht festgefahrenes Geschäft – etwa in der Raumplanung, Mobilität oder im Sozialwesen – bei dem eine informierte Abwägung aus der Bevölkerung hilfreich wäre? Oder geht es eher darum, ein Stimmungsbild einzuholen, um besser zu verstehen, wo der Schuh drückt? Diese Klärung des Bedarfs ist zentral, bevor über die konkrete Durchführung entschieden wird.
Im nächsten Schritt lohnt es sich, den Kontakt mit Personen aufzunehmen, die Erfahrung mit Beteiligungsprozessen haben – sei es aus der Forschung, aus spezialisierten Organisationen oder aus anderen Gemeinden. Gemeinsam kann dann ein Beteiligungsformat entwickelt werden, das zur Grösse, Kultur und Fragestellung der Gemeinde passt.
Grundsätzlich gilt: Bürgerinnen und Bürger sind eine wertvolle Ressource für jede Gemeinde. Wenn man sie ernst nimmt und geeignete Verfahren schafft, damit sie sich konstruktiv einbringen können, entstehen neue Perspektiven, tragfähige Lösungen – und oft auch mehr Engagement und Vertrauen in die lokale Politik.
Man darf aber auch einfach Andri Heimann anrufen, richtig?
Selbstverständlich!
Vielen Dank für dieses Gespräch.